
Die Mode im 18. Jahrhundert.
Die Vorherrschaft, die Ludwig XIV. in Europa ausübte, hat sich zwar auf allen Gebieten des Lebens in Politik, Kunst und Literatur gleichmäßig geäußert, sich doch aber auf keinem anderen so augenfällig zur Geltung gebracht als auf dem der Mode. Alle Unterschiede, welche bis dahin der Kleidung einzelner Länder und Städte ein gewisses charakteristisches Gepräge verliehen hatten, verschwinden mehr und mehr vor der unaufhaltsam vordringenden französischen Mode. Alle Ordnungen und Verbote sind vergebens. Nichts kann ihren Siegeszug aufhalten.
Die Kleidung der Gesellschaft wird im Lauf des 18. Jahrhunderts überall die gleiche, nämlich die französische, und in diesem Sinne sprach Caraccioli damals mit Recht vom französischen Europa. Die Geschichte der französischen Mode wird dadurch ganz von selbst zu einer Modegeschichte Europas, das Vorbild des Hofes von Versailles beeinflußt die Gesellschaft in Paris, und von da aus die übrige Welt. Die Mode wirkte sicher, wenn sie auch beim Herabsteigen der sozialen Stufenleiter die untersten Schichten ebensogut später erreichte wie die räumlich entfernter lebenden. Jeder formte sich doch nach besten Kräften nach ihrem Bild. Und wenn das Pariser Muster auch nicht überall erreicht wurde, so blieb es doch das Ideal, nach dem man strebte.

Es ist ja auch ganz selbstverständlich, daß man schneller dazu gelangte, die äußeren Formen der bewunderten französischen Kultur anzunehmen als ihren Geist. Wer sich französisch kleidete, dokumentierte schon dadurch seine Zugehörigkeit zu einer höheren Klasse, und diese Tendenz, sich dem französischen Geschmack anzupassen, wurde von Frankreich aus um so systematischer unterstützt, als die französischen Manufakturen zum größten Teil Luxusartikel produzierten: Samt- und Seidenstoffe, Spitzen, Tressen u. dergl. Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hatte man in Paris begonnen, alle Monat einmal eine vollständig nach neuester Mode kostümierte lebensgroße Puppe nach London zu senden: »die große Pandora« in Staatstoilette, »die kleine Paudora« in Neglige gekleidet. Diese Puppe der Rue Saint Honore wurde anfänglich im Hotel Rambouillet zurecht gemacht mit der gern geleisteten Hilfe der berühmten Mademoiselle de Scudery, jener fruchtbaren Romanschriftstellerin, die man zwar nicht mehr liest, aber aus Hoffmanns Erzählungen so gut kennt. Diese Puppe wanderte so regelmäßig über den Kanal, daß selbst Kriegszeiten die englischen Damen nicht der Möglichkeit beraubten, sich allmonatlich über die letzte Pariser Mode zu orientieren.
Siehe: Der Hirschpark des franz. Königs Ludwig XV.
Mitten im Spanischen Erbfolgekrieg bestellte König Georg I. von England die ganze Ausstattung seiner deutschen Schwiegertochter in Paris. Die feindlichen Generale erlaubten Pandora stets frei zu passieren, eine Galanterie, der erst ein Barbar, wie Napoleon, ein Ende machte. Als zu Anfang des 19. Jahrhunderts die englischen Damen auf den Besuch Pandoras zu verzichten gezwungen waren, sahen sie sich, wie Mrs. Bury-Palliser bedauernd bemerkt, leider genötigt, sich nach eigenem Geschmack zu kleiden. Nachdem sie der Not gehorchend einmal in diesen Fehler verfallen mußten, haben sie ihn leider als Gewohnheit einwurzeln lassen; von dem Resultat kann jeder Besucher Englands sich schaudernd überzeugen.
Mit der Zeit reiste Pandora auch nach anderen Orten als gerade nur nach London und formte nach ihrem Bilde in Russland wie in Deutschland und Italien aus der Europäerin die Pariserin. Wir wollen aber nicht verschweigen, daß es schon im 18. Jahrhundert Leute gab, die behaupteten, daß Pandora im Ausland stets die Moden von vorgestern und nicht die von heute trüge; so findet die Fürstin Liechtenstein die Damen des Ansbacher Hofes angezogen und dekolletiert, wie sie es nie gesehen, und Nicolai konstatiert bei seiner Reise durch Deutschland, daß das vornehme Frauenzimmer in Augsburg, Stuttgart und anderswo sich zwar französisch kleide, aber nach der vorletzten Mode! Als der Großfürst Paul von Russland 1782 in Frankfurt a. M. den Adel der Umgebung empfängt, da findet sein Hof, daß die Kleider desselben einer Mode angehören, die mindestens 40 Jahre alt sein müsse.

Die Frauenmode.
Die Mode der die Frau des 17. ins 18. Jahrhunderts war in der zweiten Hälfte der langen Regierungszeit Ludwigs XIV. entstanden und hat mit geringfügigen Veränderungen fast 40 Jahre gedauert. Ihre Stetigkeit darf man wohl auf die ernste Sinnesweise der Dame zurückführen, die in jenen Jahrzehnten am französischen Hofe den Ton angab, der Marquise von Maintenon. Der Anzug der Dame bestand, soweit er sichtbar war, aus drei Hauptstücken, der Taille mit zwei Röcken. Die Taille, tief und spitz geschnürt, ließ Hals und Unterarme frei, ein Decollete, an das sich die schöne Welt zwar sehr rasch, Moralisten und Geistliche aber nur sehr langsam gewöhnten.

In Wien hat ein Prediger sich damals in seinem Eifer so weit hinreißen lassen, daß er in der Hofkirche äußerte, er wünsche, der Adler des Evangelisten Johannes solle den Damen auf die entblößten Brüste sch ….. , und sich weigerte, dem öffentlichen Ärgernis durch Abbitte Genüge zu tun. Man beauftragte also Abraham a Santa Clara mit einer Korrektur der anstößigen Bemerkung und der fromme Mann äußerte am nächsten Sonntag von der Kanzel, er bedaure die Unanständigkeit, zu der sich sein Vorredner habe hinreißen lassen herzlich, ginge es aber nach seinen Wünschen, so müsse nicht ein Adler, sondern der Ochse des Evangelisten Matthäus dies Geschäft besorgen!
Siehe: Dühren, Studien I. Der Marquis de Sade. Das französische Königtum im 18. Jahrhundert.
Das Kleid bestand aus zwei Röcken, von denen der untere rund geschnitten und meist garniert war, der obere aber vorn aufgeschnitten, nach rückwärts hochgenommen in langer Schleppe nachfloß. Um das auf ihm lastende Gewicht der Schleppe tragen zu können, war der untere Rock abgesteift und enthielt, um seine runde Form zu behalten, eiserne Reifen im Futter. Während Taille und Schlepprock in Frankreich Manteau genannt, in Farbe und Stoff gleich waren, so durfte das Unterkleid verschieden sein. Es wurde gestickt und besetzt und trug, seitdem der Falbala, was wir heute Volant nennen, erfunden war, kaum noch anderen Besatz als solchen. Ein glücklicher Zufall hat uns den Namen dessen bewahrt, der den Falbala erfand, er hieß Langlee. Liselotte schreibt einmal wie sie angezogen ist: »Alle meine Unterröck sind mit Nesteln an mein Leibstück gebunden und le Manteau ist auf mein Leibstück genehet.« Das Leibstück ist die Taille, die mit dem Korsett in eins gearbeitet war, also in diesem Fall die ganze Last der Röcke zu tragen hatte.
Siehe: Spanische Hofmode des Barock am Hof sächsischer Fürsten und Fürstinnen
Die Erscheinung einer Dame in dieser Tracht war nicht nur vorteilhaft, sondern auch würdevoll und ansehnlich, wozu die Schleppe nicht wenig beitrug. Damit der Wetteifer der Frauen, den sie in der Länge ihrer Schleppen entfalteten, nicht zu weit gehe, wurden genaue Vorschriften darüber erlassen; so durfte in Frankreich nur die Königin eine 11 Ellen lange Schleppe tragen, während die Prinzessinnen je nach dem Grad ihrer näheren oder weiteren Blutsverwandtschaft mit dem König, sich mit solchen von fünf bis neun, Herzoginnen aber mit Schleppen von drei Ellen Länge begnügen mußten (die alte französische Elle betrug ungefähr 120 cm). Wenn die Schleppe schon das ihre dazu beitrug, die Erscheinung der Dame in die Länge zu ziehen, so wurde diese Richtung nach dem Stattlichen noch bestärkt durch den Kopfputz, die Fontange.
Die Fontange.
Bussy-Rabutin (Roger, comte de Bussy-Rabutin 1618-1693, war ein französischer Offizier und Schriftsteller), das bekannte Klatschmaul, erzählt die Geschichte ihrer Entstehung folgendermaßen. Auf einer Hofjagd in Fontainebleau war der Geliebten des Königs, der Herzogin von Fontanges, die Frisur aufgegangen und da sie nicht daran denken konnte, sie gleich wieder richten zu lassen, band sie ihr Haar geschwind über der Stirn mit einer Schleife zusammen. Der verliebte König fand, daß ihr dieses Arrangement vorzüglich zu Gesicht stände und bat sie, sich nie mehr anders zu frisieren. Grund genug auch für alle übrigen Damen des Hofes, den königlichen Wunsch zu befolgen.

Aus dieser Frisur, welche die Haare über der Stirn aufbaute, entstand, als man dieses Auftürmen nicht hoch genug fortsetzen konnte, unter Zuhilfenahme einer Coiffure endlich die berühmte Fontange, welche das kurze Glück ihrer Erfinderin um Jahrzehnte überlebte. Es war ein Kopfputz aus Leinwand von etwa zwei Fuß Höhe, der sich in der Form von Orgelpfeifen auf einer Wulst aufbaute, die in das Haar hineingearbeitet wurde. Metallstäbe gaben diesem Gerüst Halt und Façon, so daß der Abbé Vertot sagte, die Damen müßten sich eigentlich vom Schlosser frisieren lassen. Diese Coiffure wurde durch Bänder, Locken und allerhand Zierrat auf das mannigfaltigste ausgeputzt; man kannte schließlich 20 verschiedene Arten der Fontange, von denen Lady Montague besonders jene der Wiener Damen auffielen. Sie nennt sie eine Elle hoch aus unzähligen Ellen schweren Bandes in drei bis vier Stockwerken errichtet, mehrere Reihen dicker mit Diamanten und Perlen besetzter Nadeln standen etwa drei Zoll aus dem Kopf hervor und schienen dem Gebäude Halt zu geben. Montesquieu schrieb 1721 in den persischen Briefen: es gab eine Zeit, wo man wegen der unermeßlichen Höhe der Fontange das Gesicht einer Frau in der Mitte ihrer Figur sah.
Daß Edelsteine der beliebteste Schmuck der Fontange waren, nimmt nicht wunder. Mit Erstaunen erfährt man aber die Tatsache, welche Frau von Maintenon 1692 einer ihrer Freundinnen berichtet, daß nämlich die Coiffüre der Duchesse du Maine so viel Gold und Edelsteine enthielt, daß sie mehr gewogen habe, als der ganze Körper ihrer Trägerin. Der erste, welcher sich gegen diese Ausschreitungen der Mode wandte, war Ludwig XIV. selbst. Aber merkwürdig, der Wunsch eines verliebten Königs hatte zwar die Fontange in die Mode gebracht, aber der Befehl desselben Herrschers konnte sie nicht wieder abschaffen.
Frau von Sevigne (Marie de Rabutin-Chantal, Marquise de Sévigné) schreibt 1691 ihrer Tochter: ganz Versailles sei in Aufruhr, weil der König die Fontangen verboten habe. Ein Sturm im Wasserglas. Dangeau erzählt, daß nur die im Exil in St. Germain lebende Königin von England Maria von Modena dem Könige zu Gefallen ihre Coiffure bedeutend niedriger gemacht habe, um den Damen ein gutes Beispiel zu geben. Die verbotene Fontange existierte noch länger als 20 Jahre und mehr als einmal, berichtet der Herzog von St. Simon, habe Ludwig XIV.sich darüber beklagt, daß seine Macht nicht so weit reiche, um den Damen eine Coiffüre zu verbieten, die ihm mißfiele. Endlich schlug ihre Stunde.
Im Jahr 1714 war eine englische vornehme Dame, die Herzogin von Shrewsbury beim Diner des Königs in Versailles Zuschauerin, und mit Bezug auf ihren niedrigen Kopfputz äußerte der König, die französischen Damen wüßten doch gar nicht, was ihnen stände, sonst würden sie sich ebenso frisieren. Dies war ein Wort zur rechten Zeit! Am anderen Morgen hatten die Damen des Hofes ihre Coiffüren um zwei Stockwerke niedriger gemacht und damit die neue Mode inauguriert. So hat der Sonnenkönig, ehe sein Gestirn erlosch, wenigstens noch den Beginn jenes großen Umschwungs mit angesehen, der unmittelbar nach seinem Tode einsetzt, um in der Gesellschaft, der Kunst, der Mode, der ganzen Kultur mit einem Wort, eine neue Ära heraufzuführen.
Wie immer in diesen Dingen schwankte die Mode von einem Extrem zum anderen. Hatte sie eben die Frisuren mittels der Fontange nicht hoch genug aufbauen können, so verbot sie im nächsten Augenblick mit den Coiffuren auch die kunstreichen Frisuren. Die Damen sahen sich auf ihr eigenes Haar beschränkt, das sie nun auf einmal nicht glatt, nicht flach genug um den Kopf legen konnten. Einige Löckchen an den Schläfen war alles, was die Mode duldete. Die systematische Übertreibung, in der aber das Wesen der Frauenmode wohl beschlossen scheint, suchte sich einen anderen Tummelplatz und fand ihn im Rock. Die Fontange verschwindet, der Reifrock erscheint und gibt der Mode des Rokoko ihre eigentümliche Signatur.
Der Reifrock.
Der Reifrock war durchaus nicht neu. Das 16. Jahrhundert hatte ihn als Vertugadin gekannt und im 17. Jahrhundert hatte er der spanischen Mode den grotesken Charakter verliehen, der uns an den Porträts des Velasquez so frappiert. Er war nie so ganz verschwunden. denn wenn Liselotte 1702 ein Kleid beschreibt, das die Königin von Spanien ihrer Schwester, der Duchesse de Bourgogne schenkt, und sagt: „Im Unterrock seynd eiserne Reiffen, unten weit, im Heraufgehen enger“, so gibt sie damit ein gut getroffenes Bild der Krinoline. Aber in dieser Form war der Reifrock nur ein unsichtbares Hilfsmittel der Toilette gewesen, um die Last der schweren Robe tragen zu helfen, von jetzt an drängt er sich vor, denn er gibt der Trägerin einen ganz veränderten Umriß. Als Tugendwächter – Vertugadin – war er verabschiedet worden, als Hühnerkorb – panier – kam er wieder. Soweit die Nachrichten gehen, erschien er, von England kommend, zum erstenmal 1719 in Paris im Theater.
Siehe: Die männliche Garderobe zur Zeit von Ludwig XV. Der Herrenrock, Justaucorps. Paniers, die Reifröcke, die Krinoline im Zeitalter des Rokoko und Barock des 18. Jahrhunderts.
Es hat fast den Anschein, als hätten ihn die italienischen Komödianten, die der Herzog von Orleans nach Paris zurückrief, mitgebracht. Allgemeines Gelächter empfing ihn: sein Sieg war entschieden. Die heftigen Anfeindungen, denen er vonseiten der Geistlichkeit ausgesetzt war, ein Mitglied der Sorbonne, J. J. Duget, machte ihn zum Studium einer Gewissensangelegenheit für Beichtväter, haben ihm nicht geschadet, denn ehe der Erzbischof von Paris, Kardinal de Noailles dazu kam, das Tragen des Reifrockes zu verbieten, hatte ihn der Lustspieldichter Legrand 1722 in einer Posse so verhöhnt, daß der Kirchenfürst seine Absicht aufgab.
Über 40 Jahre hat er geherrscht und das Bild der weiblichen Erscheinung bestimmt. Die Reifröcke waren anfänglich rund und bestanden aus fünf Reihen von Reifen, die sich nach oben verjüngten und durch Wachstuch miteinander verbunden waren. Das Geräusch, das sie beim Tragen machten, zog ihnen den Namen Kreischerinnen – Criardes – zu. Dann nahm man an Stelle dieses häßlichen Stoffes Wolle, Baumwolle oder Seide und begann die Abwechslung in der Veränderung der Form zu suchen. Man machte den Reifrock tonnenförmig oder gab ihm seit dem Beginn der vierziger Jahre die ovale Gestalt einer Ellipse, indem man ihn von vorn und hinten flach zusammendrückte. Dann hob man ihn an den Seiten durch Aufbinden von Poches über die Hüften hinaus, so hoch, daß der Ellenbogen einen bequemen Ruheplatz darauf fand, und gab ihm eine Größe, die den untersten Reifen 7-8 Ellen, den obersten etwa noch 4 Ellen messen ließ. Die Damen, welche solch einen Käfig trugen, konnten nur seitwärts durch die Türen gehen, der Herr, der sie führte, mußte einen Schritt vor oder hinter ihnen zurückbleiben. Wenn sie sich setzten oder mehrere beisammen waren, so beanspruchten sie dreimal soviel Platz als bisher.
Der weimarische Hofpage Karl Freiherr von Lyncker besann sich darauf, daß, wenn die Herzogin Anna Amalia Sonntags in ihrer Glaskutsche ausfuhr, ihr Reifrock zu beiden Fenstern weit herausragte. Zu manchen Bällen in Paris und den Hofbällen in Berlin enthielt die Einladung den Vermerk: »Die Damen ohne Reifröcke«. Das veranlaßte sofort Zank und Streit. In Versailles fand man es der Würde der Königin nicht entsprechend, daß die Prinzessinnen, die rechts und links von ihr saßen, sie mit ihren Reifröcken vollständig verdeckten, es wurde also angeordnet, daß die Stühle neben Maria Leszczyńska frei bleiben sollten. Nun verlangten aber die Prinzessinnen von Geblüt, daß auch sie durch leere Sessel von den Herzoginnen geschieden würden und die Herzoginnen wollten nicht mehr unmittelbar neben den Gräfinnen Platz nehmen. Es entstand ein Aufruhr, der den Frieden des Hofes gefährdete und den zu beschwichtigen erst der Weisheit des Premierministers, des Kardinals Fleury, gelang. Er ließ leere Tabourets zwischen Prinzessinnen und Herzoginnen einschieben, Herzoginnen und Gräfinnen aber mußten nebeneinander sitzen bleiben und sich mit Reifröcken und Schicksal abfinden, so gut sie konnten. Diese Haupt- und Staatsaffäre findet ein Gegenstück in Deutschland, wo die Pfarrerin in Fürstenau mit Rücksicht auf ihren Reifrock zwei Kirchenstühle für sich allein beanspruchte und es darüber sogar zum Prozeß kommen ließ.
Der Reifrock verbreitete sich mit großer Schnelligkeit in alle Kreise. In Paris gehen in den zwanziger Jahren schon die Mägde darin auf den Markt, während die deutschen Damen viel weniger nachsichtig gegen ihr Küchenpersonal waren. Sie ließen den niederen Ständen das Tragen des Reifrockes verbieten, in Sachsen hat man 1743 im Dorfe Dennschütz zwei Bauernmädchen prozessiert, weil sie in Paniers gingen, und 1751 in Dresden zwei Dienstmädchen gestraft, weil sie sich erlaubten, im Reifrock die Kirche zu besuchen. Als den Leipziger Mädchen 1750 der Reifrock von der Obrigkeit genommen wurde, gestattete man ihnen zur Entschädigung eine »Commode« zu tragen, was wir heute Cul de Paris nennen. Der Reifrock drang bis in die klösterlichen Erziehungsinstitute, trotzdem die Geistlichen eine Gewissensfrage daraus machten, ob Klosterfrauen ihren Klosterfräulein den Reifrock gedulden dürfen?
Die kleinsten Mädchen trugen ihn wie die ältesten Damen. Hat doch 1737 Frau von Bussy in Verdun, die ihr Leben bis auf 111 Jahre gebracht hatte, sterben müssen, weil sie beim Anprobieren eines neuen Reifrockes einen Fehltritt tat. Beim Hinfallen beschädigte sich die alte Dame tödlich, während der neue Reifrock glücklicherweise keinen Schaden nahm. Man benutzte bald statt der eisernen oder hölzernen Reifen, welche man anfangs verwendet hatte, solche von Fischbein und der enorme Bedarf an diesem Material – brauchte man doch zu einem gewöhnlichen Reifrock fünf, zu einen sogenannten englischen aber acht Reifen – veranlaßte die Generalstaaten von Holland, schon im Jahre 1722 zur Gründung einer Aktiengesellschaft mit 600000 Gulden Grundkapital, zu keinem anderen Zweck, als zum Walfischfang.
In Paris schwankte der Preis eines Paniers zwischen 10-15 Livres [1 Livre ist nach heutigem Geldwert 2,40 Mark]. in Leipzig kostete auch ein Reifrock mindestens 8 Taler [was heute ungefähr 72-75 Mark gleichkommen würde]. Wenn man auch damals noch keine Witzblätter im heutigen Sinne kannte, an Spott, der über den Reifrock ausgeschüttet wurde, hat es nicht gefehlt. Auf der Bühne wurde er vorn Harlekin verhöhnt, in Liedern, Karikaturen und Flugschriften lächerlich gemacht, von der Kanzel wurde gegen ihn geeifert. Das hat ihm alles nichts geschadet, denn als er zu verschwinden begann, da wich er nicht der Vernunft oder Einsicht, sondern der Veränderungslust der Mode. Die Pariser Schauspielerinnen Clairon und Hus sollen um 1760 eine Form des Reifrocks getragen haben, die von den Hüften nur bis zum Knie reichte und in einem Volant endigte. Man nannte sie in Frankreich halbe Paniers oder Jansenistinnen, in Deutschland Springrock oder Hänschen, bald aber wurde diese kleinere Form durch eine neue Erfindung verdrängt.
Monsier Parnard gab den Damen die «Considérations«, Gerüste in der Gestalt von Tornüren, die rechts und links auf beiden Hüften befestigt wurden und den großen Reifrock entbehrlich machten. Diese beiden Hauptformen bestanden nebeneinander fort. Die eine zum großen Putz, die andere zum bequemen Anzug. Auf den reizenden Wiener Ansichten von Janscha und Schütz erkennt man in der Staffage, die diese Blätter so anschaulich macht, wie der große breite und der kleine, runde Reifrock gleicherweise beim Spaziergang getragen wurden. Der eine mit langer Robe und kleiner, zum Anknöpfen eingerichteter Schleppe, der andere mit einem völlig fußfreien Kleid.
Vorlesungsreihe: ASPEKTE ZUR GESCHICHTE DER KUNST. Kunstgeschichte – 21. Vorlesung – DIE KUNST DES 18. JAHRHUNDERTS. Vortragende: Univ.-Prof. Dr. Daniela Hammer-Tugendhat
Als in den siebziger Jahren die Aufmerksamkeit der Mode sich fast ausschließlich der Frisur zuwendet, wird der Rock vernachlässigt. Der große Panier verschwindet allmählich ganz und hält sich nur noch als Zeremonienkleid des Hofes. In Versailles hat er noch die ersten Stürme der Revolution erlebt. Die letzte Dame, die sich einen Reifrock für ihre Vorstellung bei der französischen Königin Marie Antoinette bestellte, war wohl Frau v. Lostanges, die am 31. August 1789 an Mademoiselle Motte 102 Livres für ihn bezahlte. Er versank dann mit allem übrigen Brimborium des Hofes und hat sich nur noch am Hofe von St. James bis zum Tode der Königin Charlotte und noch länger am sächsischen Hofe in Dresden behauptet.
So groß die Veränderung war, die der Rock der Damen im 18. Jahrhundert erfuhr, so gering war diejenige der Taille. Diese behielt im großen Ganzen die Form, welche sie unter Ludwig XIV. erhalten hatte, sehr tief und sehr spitz schnürend, Hals und Unterarme freilassend. Der Ärmel, der am Ellenbogen in weiter Manschette endigte, hat diese überaus kleidsame Form beinahe ein Jahrhundert beibehalten. Man nannte, wie der Mercure galant von 1688 berichtet, die drei- oder mehrfache Reihe Spitzen, in denen er aufhörte, »Engageantes« ( frz: „Einmischerinnen“, sind lange Spitzenvolants an den Ärmeln von Frauenkleidern).
Der Schnürleib.
Das weibliche Wesen war von seinem zartesten Alter an, die meisten Tag und Nacht, mit dem Schnürleib gepanzert, dessen Planchette aus einer Eisen-oder Stahlschiene bestand, die 3/4 Ellen lang, etwa 1 Finger breit und 1/4 Zoll stark war, ein Marterinstrument, gegen dessen Gesundheit schädigende Wirkung sich Ärzte, wie der Breslauer Gottlieb Ölsner, schon 1754 vergebens wandten, an das Frau von Genlis (Félicité de Genlis) noch fünfzig Jahre später nur mit Entsetzen denken konnte.
Gräfin Elise von Bernsdorff (1789-1867) erzählt, daß viele Damen, die Abends in Gesellschaft gingen, schon am frühen Morgen mit dem Schnüren begannen und damit von Viertelstunde zu Viertelstunde fortfuhren. Gräfin Franziska Krasinska berichtet, daß ihre Taille den Umfang einer halben Elle (30 cm?) nicht überschritt. Rousseau, Winslow, Buffon, Sömmering u. a. haben gegen den Schnürleib geeifert, mit dem gleichen Mangel an Erfolg; erst am Ende des 19. Jahrhunderts hat es der Mode gefallen, dasselbe ganz vorübergehend zu beseitigen. Anfänglich hatte man als Besatz der Taille nur vorn am Ausschnitt ein Schleifchen »Masche«, wie man damals sagte – als Postillon d’amour gesteckt. Diese kleidsame Verzierung aber fand lebhaften Beifall und in der Mitte des Jahrhunderts war die ganze Korsage in Schleifen aufgelöst. Später trug man das Korsett aus schwarzem Taft oder gelbem Batist auch über dem Kleid.
Die Mode der doppelten Röcke behielt man auch im 18. Jahrhundert bei, wie früher der untere Rock, so wurde jetzt der Reifrock sichtbar getragen. Anfänglich hob man den oberen Rock nicht, sondern öffnete ihn nur vorne in Dreieckform. Als dann in den fünfziger Jahren der Reifrock an Umfang verlor, und das Kleid kürzer, schließlich völlig fußfrei wurde, raffte man den oberen Rock in drei großen Bäuschen rückwärts und an den Seiten. Da der Reifrock zu sehen war, so wurde er aus den gleichen Stoffen, wenn auch in anderen Farben verfertigt, wie das Überkleid und meist reich garniert, wozu seine Form ja auch geradezu herausforderte. In mehreren Etagen umzogen ihn Volants, Rüschen, Bänder, Blumen, Festons, Tressen, Spitzen, Passementerien, Borten, Pompons, Stickereien, alles auf das kunstreichste gearbeitet und arrangiert.
Sehr beliebt waren die italienischen Blumen, die in italienischen Nonnenklöstern gemacht wurden, und von den Damen sehr geschätzt wurden. Goethe erzählt, wie er als halbwüchsiger Jüngling Myrten und Zwergröslein für seine Schwester besorgte – weniger aus brüderlicher Liebe, als um bei der Gelegenheit – Sie – sehen zu können. Der Marquis de Bombelles (Marc Antoine Marie Marquis de Bombelles, 1744-1822) beschrieb dem Baron von Gleichen (Karl Heinrich von Gleichen, 1733-1807) zwei Hofroben der Königin von Portugal. Auf der einen sah man in Stickerei ein Portal, dessen Säulen der Richtung der Beine folgten. Sie trugen ein Fronton aus dem ein Wasserfall von Gaze hervorbrach. Auf der anderen waren Adam und Eva dargestellt, in ihrer Mitte der verhängnisvolle Apfelbaum, aus dessen Höhe die Schlange herabkam.
Zur Herstellung einer großen Robe waren drei Leute nötig. Die Taille fertigte der Schneider, den Rock die Schneiderin, den Besatz aber lieferte die Marchande de mode, deren Garnituren fast die Hauptsache waren. Man hatte 1779 an die 150 verschiedene Arten derselben, die in Paris alle ihre bezeichnenden, zum Teil sehr drolligen Namen trugen, »soupirs étouffés«, »regrets superflus«, »oeil abattu«, »plaintes indiscrètes«, »composition honnête«. »désirs marqués«, »doux sourire « etc. etc. Eine solche Toilette kostete 10500 Livres, für die bloße Dekoration eines großen Hofkleides berechnete der Schneider Lacoste einmal 3500 Franken. Die Prinzessin de Solre zahlte 1789 an Mademoiselle Eloffe nur für ihren Reifrock 1382 Livres, ja Frau von Matignon wies ihrer Schneiderin für eine besonders gelungene Robe eine Leibrente von 600 Livres jährlich an. Als Frau von Genlis in ihren Denkwürdigkeiten auf diese Mode ihrer Jugend zu sprechen kommt, sagt sie, daß nichts der Pracht gleichkam, den der Anblick einer Gesellschaft reich gekleideter Hofdamen jener Zeit bot.
Sie hätten einem kostbaren Spalier von Gold, Silber, Perlen und Edelsteinen geglichen. Das Kleid, in dem die russische Kaiserin Katharina II. 1775 den türkischen Gesandten empfing, war außer mit Diamanten mit 4200 großen und schönen Perlen bestickt. Und nun stelle man sich vor, daß die Kaiserin Elisabeth von Russland, die 1761 verstarb, eine Garderobe hinterließ, die 15000 derartig kostbare Kleider enthielt! Sie hatte sie teils nur einmal, teils nie angehabt.
Welch ein Fortschritt gegen die Zeit, als Peter der Erste die Kleider seiner Zarina auf dem Trödel kaufte!
Gräfin Czernicheff büßte 1770 auf einer Reise durch Schiffbruch 158 Kleider ein. Die Garderobe der Frau von Bühren, der Gattin des Günstlings von Kaiserin Anna, wurde auf 500.000 Rubel geschätzt. Dagegen erscheint der Aufwand Marie Antoinettes geradezu bescheiden. Wir erfahren von Madame Campan, daß die Königin im Sommer und im Winter nie mehr als 36 Roben in Gebrauch hatte, 12 Staatskleider, 12 große Reifröcke und ebensoviele Hauskleider von Phantasiestoffen. Eine rechte Kleidernärrin, wenn auch in bescheideneren Grenzen als die russische Kaiserin, muß die Markgräfin Sybille Auguste von Baden gewesen sein, die sich für ihr Lustschloss Favorite in Rastatt, vierzig mal porträtieren ließ, jedesmal in einer anderen Toilette. Neben dieser Zeremonien- und Staatsrobe setzt sich im Laufe des Jahrhunderts noch ein anderer Schnitt durch, der für Néglige galt und seinen Namen häufiger wechselte als seine Form. Unter Néglige verstand man damals jedes Kleid, das nicht für große Gala bestimmt war, also auch jedes Haus-, Straßen-, und Reisekleid.
Die Adrienne.
Bei diesem neuen Kleid waren Taille und Rock in eins geschnitten. Es war weit, lang und umhüllte, ohne am Gürtel eingenommen zu sein, seine Trägerin nur ganz lose, ihr die Gestalt eines Kegels gebend. Es ist das Kostüm mit der weiten Rückenfalte, in dessen legeren Wurf Watteau auf seinen Bildern die Frauen am liebsten kleidet. Es trat zugleich mit der Einführung des Reifrocks auf und begegnete starker Mißbilligung. Liselotte, welche findet, daß man »kammermegtisch« darin aussehe, schreibt 1721 ihre Meinung ganz unverhüllt: »Die weitte rock, so man überall tragt, seind mein aversion, stehet insolent, als wenn man auß dem Bett kommt. Die Mode von den wüsten Röcken kompt von Madame von Montespan so es trug, wenn sie schwanger war. Madame d’Orleans hat sie wieder auf die Bahn bracht.« Diejenige, welche dieses Kleid in die Mode lancierte und ihm den Namen »Adrienne« gab, war die Schauspielerin Madame Dancourt, die den Schnitt 1703 zuerst auf der Bühne trug. Sie spielte in der Komödie Andrienne von Baron die Glycerie und trat darin der Situation ihrer Rolle entsprechend in diesem Umstandskleid auf.
Die Aversion der guten Pfälzerin ist nicht leicht zu begreifen, denn diese weiten Kleider erforderten ebensogut das Korsett, wie der große Habit, ihr Néglige bestand nur für das Auge in dem losen Wurf ihrer Falten. Wie aber das Neue Gegner schon aus dem Grund findet, weil es neu ist, so wurde diese »Adrienne« 1730 in Wien verboten. Die Frauen sollten nicht, wie Keyßler schreibt, um ihre Fleischbänke desto besser auslegen zu können, in französischen Säcken zur Kirche kommen. Zu den Zeiten der Montespan hatte dieses Umstandskleid den Namen »Innocente« geführt. Dann hieß es »Adrienne« oder »Volante«, führte auch eine Zeitlang nach der Gattin des Malers Pater die Bezeichnung »Hollandaise«, In England nannte man die weiten Kleider 1754 »Cardinals«, »Trollopies«, »Slammerkins«, in Deutschland am liebsten Kontusche. In Gellerts Lustspiel »Die kranke Frau« bildet die neue Adrienne der Frau Stephan den Drehpunkt des ganzen Stückes.
Die Kontusche.
Die Kontusche (Contouche) gewährte reisenden Prinzessinnen eine Art Inkognito. So erfindet die Markgräfin von Bayreuth, als sie zur Krönung nach Frankfurt reist, für sich und ihre Hofdamen einen besonderen Schnitt derselben. Als Marie Antoinette 1778 zum ersten Male in anderen Umständen war, brachte sie ihr Umstandskleid als „Levite“ in die Mode. Sie ließ sich auch von Madame Vigée Lebrun in diesem Kostüm malen. Als das Bild aber im Salon von 1783 ausgestellt wurde, erregte es beim Publikum solchen Anstoß, daß es entfernt werden und durch ein Porträt in großem Putz ersetzt werden mußte. Dieser Form fügte die Vicomtesse de Jaucourt 1781 noch eine Schleppe »à queue de singe« hinzu. Als die Dame zum ersten Mal im Garten des Palais Luxembourg in geschwänzter Affenform promenierte, trieb sie der Hohn der Spaziergänger in die Flucht. Man nannte den Schnitt auch »Polonaise«, Pierrot, Circassienne, Robe à la turque, à la Créole etc.

Schließlich wird hoch und geschlossen mit langen Ärmeln die Robe à l’anglaise daraus, wie sie Reynolds, Gainsborough u.a. so oft mit ihren schönen Modellen gemalt haben. Es ist das Kostüm, aus dem einige Jahre später das antike wird, wie es einzelne besonders mutige Damen auch schon früher zu tragen versucht haben. Die schöne Elisabeth Chudleigh, als nachmals vermählte Herzogin von Kingston durch ihren famosen Bigamieprozeß so bekannt geworden, erschien 1749 auf einem Subskriptionsball in Somerset House in London als Iphigenie vor dem Opfer, wurde aber ihrer dürftigen Bekleidung wegen auf Veranlassung des Hofes aus dem Saal gewiesen, während Corona Schröter, die 1778 ihr antikisierendes Gewand »in edler attischer Eleganz« auch auf der Straße trug, in dem Weimar der Geniezeit nur Bewunderung erntete.
Der Caraco.
Seit der Mitte des Jahrhunderts bildet sich noch ein anderes Négligekostüm heraus, der Caraco. So nannte man eine Taille mit Schößen, die ihre Einführung in die Mode dem Herzog von Aiguillon verdanken soll, welcher 1768 bei seiner Reise durch Nantes die dortigen Bürgerfrauen damit bekleidet sah. Im Grunde genommen ist der Caraco aber wohl nichts anderes als der für die Damenmode adaptierte Herrenfrack. Der Schnitt des Kleidungsstückes hat sehr oft gewechselt und dem Caraco, den man auch Casaque und Casaquin nannte, die aller verschiedensten Formen gegeben. Manchmal waren die Schöße rückwärts sehr kurz, – »Caraco pet en l’air« -, dann verlängerte man sie gelegentlich sogar bis zur Schleppe, dann wieder fielen sie nicht flach auf den Rock, sondern man bauschte sie um die Hüften. Mal waren es mehrere Schöße, mal nur einer, kurz, man hat diesem Kleidungsstück, das sehr beliebt war und bis in die Mitte der neunziger Jahre getragen wurde, die mannigfaltigste Abwechslung zu geben gewußt, zumal es stets von anderer Farbe und anderem Stoff gewählt war als der dazu gehörige Rock.
Siehe: Der Casaquin, pet-en-l’air oder Caraco. Historische Figuren und Modetypen unter Ludwig XV. Der Casaquin, pet-en-l’air oder Caraco ist eine Frauenjacke, die von der Mitte des 18. bis frühen 19. Jahrhunderts in Mode war.
Stoffe und Farben.
Solange der große Reifrock getragen wurde, dessen Form und Umfang schöne Stoffe voll zur Geltung brachte, waren Seide, Damast, Brokat außerordentlich beliebt. Wir können die herrlichen Muster und Farben derselben noch auf den Bildern jener Zeit bewundern. In der Delikatesse seiner Farben ist das Rokoko ja heute noch nicht übertroffen. Die matten Töne seines Blau, Rose, Grün müssen in ihrer zarten Nuancierung, im Raffinement ihrer Zusammenstellung für das Auge von unbeschreiblichem Reiz gewesen sein. So besaß 1734 Frau von Bülow geb. von Arnim ein Schleppkleid aus Taffet mit eingewebten Jonquillen, für das sie 40 Reichstaler, nach heutigem Geldwert etwa 600 Mark, bezahlt hatte. In den späteren Jahren der Regierung Ludwigs XV. bewegten sich die bevorzugten Farben auf einer Skala zwischen tiefem sattem Rot und Lichtbraun, während die ersten Jahre Ludwig XVI. durch die Vorliebe für ein in das Violette spielendes Braun gekennzeichnet werden, das man flohfarben nannte und in den verschiedensten Schattierungen besaß. Da gab es die Farben: Junger und alter Floh, Flohkopf, Flohrücken, Flohbauch, Flohschenkel, Floh im Milchfieber usw. In Gelb war die beliebteste Nuance ein blasses Blond, das von der Farbe des Haares der Königin Marie Antoinette genommen war, später ersetzte es ein tiefer gefärbtes Chamois, das man in geschmackvoller Weise »caca Dauphin« oder gar »merde d’oie« nannte.

Man schwelgte in Paris förmlich darin, den Modefarben die verdrehtesten Namen zu geben: Rinnstein, Straßenschmutz, Londoner Rauch, Nymphenschenkel, Nönnchenbauch, Karmeliterbauch, vergifteter Affe, sterbender Affe, lustige Witwe, traurige Freundin, der auferstandene Tote, Stutzers Eingeweide, kranker Spanier, Verstopftenfarbe, Pockenkrank u.s.w. ist eine Blütenlese der törichten Namen, mit denen die einzelnen Schattierungen von Gelb und Grün bezeichnet wurden.
Die Gold- und Silberbrokate des 18. Jahrhunderts sind in ihrer Qualität unübertroffen geblieben. Man fertigte goldstoffene Roben auch ganz ohne Naht, deren Preis aber so exorbitant war, daß ihn die Königin von Frankreich, Marie Lesczynska unerschwinglich fand. Gräfin Stroganow wurde 1763 in Berlin der Königin vorgestellt in einem Kleid von Goldbrokat, besetzt mit Silberspitzen und verziert mit Juwelen für 20000 Rubel »wie eine Sonnengöttin«, schreibt Graf Lehndorff. Für die Börsen Minderbemittelter gab es bedruckte Baumwollstoffe und Kattune, die sich aller obrigkeitlichen Verfolgung zum Trotz siegreich durchgesetzt haben. Friedrich Wilhelm I., der die Erzeugnisse seiner Tuchmanufakturen schützen wollte, bestrafte das Tragen englischer bedruckter Baumwollzeuge mit dem Halseisen. In Leipzig wurde der Kattun noch 1750 ausdrücklich verboten. Am heftigsten aber wütete man in Frankreich gegen die »Indienne«. Diese billigen, leichten, mit schönen Mustern und in leuchtenden Farben bedruckten Stoffe wurden gegen Ende des 17. Jahrhunderts nicht so bald bekannt, als die Regierung ihre Konkurrenz für die kostbaren Gewebe der französischen Seidenindustrie fürchtete und ihren Gebrauch verbot. Daraus, daß sich von 1697-1715/25 Verbote einander folgten, geht schon hervor, wie wenig sie nutzten, und in dieser Einsicht griff das Gouvernement zu wahrhaft drakonischen Maßregeln. Man bedrohte 1717 die Händler, die noch ferner diese verpönten Stoffe einführen oder verkaufen würden, mit der Galeerenstrafe, man ließ den Frauen und Mädchen des Bürgerstandes öffentlich solche Kleider vom Körper reißen. Noch 1755 wurde, wie Grimm schreibt, die Verurteilung zu den Galeeren ausgeführt, es nutzte alles nichts.
Der Verbrauch bedruckter Kattune (Baumwollgewebe) für Kleider, Möbel und Tapeten stieg mit jedem Jahr. Es wurde schließlich ein Sport, gerade diese Stoffe zu benutzen, die verboten waren und nur als Konterbande ins Land kommen konnten. Die Pompadour war 1755 stolz darauf, daß in ihrem Schlößchen Bellevue alle Möbel mit geschmuggeltem Kattun bezogen waren. Endlich gab die Regierung nach. 1760 wurden die Verbote aufgehoben und zu den ersten, die sich auf die Herstellung von Indienne (bedruckter Baumwollstoff) warfen, gehörte der bekannte Glücksritter Casanova. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts verdrängten dann die leichten englischen Gewebe Musselin, Battist, Linon die Kattune. Die Eleganz beruht nicht mehr auf der Kostbarkeit der Stoffe, oder dem Geschmack ihrer Musterung, sondern auf der Feinheit des Fadens.

Das Brautkleid
Die Dubarry (Marie Jeanne, comtesse du Barry, Mätresse des französischen Königs Ludwigs XV.) kaufte sich ein Stück indischen Musselin, ausreichend für vier ganze Kleider, das nur 15 Unzen wog. Man trug diese leichten Gewebe mit Vorliebe ganz weiß, aber es ist merkwürdig, daß das Brautkleid damals durchaus nicht immer weiß war.
Eine deutsche Braut des Mittelstandes trug 1750 bei der Trauung einen Rock von brauner, mit roten und gelben Blumen durchwirkter Seide und dazu eine Schnürbrust von grasgrünem gros de Tours, mit Gold gesteppt. Am französischen Hof und in der vornehmen Gesellschaft trug das Brautpaar am Hochzeitstag Goldbrokat auf schwarzen Grund. Wir begegnen in französischen Modejournalen z. B. Brautkleidern in Blau und nur in den oberen Kreisen Deutschlands setzt sich im Laufe des Jahrhunderts das reine Weiß für diesen Zweck durch. Das Brautkleid von Fräulein v. Pannewitz, die 1751 heiratete, besteht aus weißem Moire mit silbernen Blumen und kostet 1000 Taler, Fräulein v. Alvensleben, die 1761 heiratet, trägt weiße Seide mit Silber broschiert. Als Dorothea Schlözer 1787 in Göttingen zum Dr. phil. promoviert, kleidet sie sich auf Wunsch der Mutter »wie eine Braut« ganz in weißen Musselin mit weißer Flor-Frisur, nur Rosen und Perlen im Haar.
Unterkleider.
Wenn man sich vorstellt, dass der große und weite Reifrock den Unterkörper der Frauen zwar bedeckte, aber doch so gut wie gar nicht schützte, so würde man glauben müssen, die Trägerinnen desselben hätten aus Rücksichten der Gesundheit und des Anstandes gern zur Hose gegriffen, aber dem war durchaus nicht so.
Es galt sogar direkt für unschicklich, und nur von alten Damen, wie Liselotte, hört man, dass sie wollene Hosen tragen, sonst war es nur in gewissen Fällen als Ausnahme gestattet. Selbst die Mägde des Herrn Hope in Amsterdam zogen Hosen nur an, wenn sie Fenster putzten. Die Holländerinnen legten sonst nur zum Schlittschuhlaufen solche von schwarzem Sammet an.
Casanova, unzweifelhaft ein kompetenter Sachverständiger in allen Fragen, welche die Dessous des schönen Geschlechts betreffen, konstatiert mit Missbilligung, wenn eine Dame, der er den Hof macht, etwa Hosen von grünem Samt trägt. Der liebenswürdige Schwerenöter geht sogar so weit, Damen, mit denen er im Postwagen zusammen fährt, Vorwürfe darüber zu machen, dass sie schwarze Beinkleider anhaben.
Eine Ausnahme von dieser Regel machten nur die Tänzerinnen auf dem Theater, welche Hosen tragen mußten und denen in Spanien z. B. bei Strafe verboten war, sie bei ihren Sprüngen sehen zu lassen. Casanova erzählt von der Prima Ballerina Nina in Barcelona eine famose Geschichte. Durch die Lebhaftigkeit ihres Temperamentes hingerissen, gab sie eines Abends bei der Rebaltade – einem Rückwärtssprung mit Pirouette – ihrem Reifrock einen solchen Schwung, daß das verpönte Kleidungsstück ganz und gar zu sehen war, und mußte demgemäß eine Geldstrafe zahlen. Wütend darüber zog sie am nächsten Abend ihre Höschen erst gar nicht an und gab bei der Rebaltade auch dem ganzen Parterre Gelegenheit, sich davon zu überzeugen. Als sie darüber vom Gouverneur zu Rede gestellt wurde, erwiderte sie ganz kalt: »Es ist mir nur verboten, meine Hosen zu zeigen, und ich glaube, kein Mensch kann behaupten, daß er sie heute abend gesehen hat.«
Unterröcke waren selbstverständlich unerläßlich. Auf den obersten derselben, der oft sichtbar wurde und in Deutschland auch den Namen »Appetitröckl« führte, wendete man viel Sorgfalt. Er wurde aus Seide gefertigt, gestickt, mit Gold und Silber bordiert und wir hören, daß besonders die schottischen Damen ihre Jupons außerordentlich reich ausgestattet haben, da die engen Gänge und Treppen ihrer alten Häuser sie fortwährend nötigten, ihre Reifröcke aufzuklappen. Als die leichten Musselinkleider Mode wurden, kamen die Unterröcke aus dem gleichen Stoffe auf. Man benötigte dieselben stets in größerer Anzahl, so daß z. B. Sophie Arnould 1789 aus ihrem Landhause in Clichy gleich 17 weiße Unterröcke aus Battist und Baumwolle gestohlen werden konnten.
Zur Vervollständigung der Toilette gehörte noch das Fichu, das kreuzweise gebunden den Ausschnitt bedeckte und kurz vor der Revolution als »Trompeuse« bis zum Kinn hinaufstieg, und die Schürze, die man auch außerhalb des Hauses trug. Ein kokettes Tändelschürzchen, das der Trägerin das Aussehen einer Soubrette gab, und deswegen, als die Mode aufkam, von den Müttern in Acht und Bann getan wurde. Die Marschallin von Luxemburg schenkte ihrer Enkelin, der Herzogin von Lauzun, um sie auf die Lächerlichkeit dieser Mode aufmerksam zu machen, eine Schürze aus Rupfen, über und über mit den kostbarsten Spitzen besetzt. In England wurde die Schürze aus Spitzen die Rage der schönen Welt, trotzdem sich einige Dandies gegen sie erklärten. In Bath ging einer derselben, Richard Nash – »le beau Nash« – soweit, der Herzogin von Queensberry, als sie mit einer Schürze im Wert von £200 zu einer Reunion kam, dieselbe abzureißen und in die Ecke zu werfen.
Die Spitzen und Wäsche.
Der Luxus in der Wäsche erstreckte sich nicht, wie heutzutage, auf den häufigen Wechsel derselben. Der Kurfürst von der Pfalz z. Bspl. gab seiner Tochter, die den Bruder Ludwigs XIV., den Herzog von Orleans, heiratete, nur sechs Tag- und sechs Nachthemden in ihren Trousseau, genug, wenn man, wie Scarron von den Damen seiner Zeit sagt, gewohnt ist, nur einmal im Monat das Hemd zu wechseln.
Die achtzigjährige Marquise von Coislin äußerte sich einmal sehr ungehalten zu Chateaubriand über ihre Kammerjungfer, die ihre Wäsche so oft wechsle. „Was hat das für einen Sinn«, sagte sie, »zu meiner Zeit hatten wir nur 2 Hemden, die man erneuerte, wenn sie verbraucht waren. Aber wir trugen dafür seidene Roben.« Fürst Khevenhüller stellte fest, daß sich in der Ausstattung der Erzherzogin Josepha 1767 zwar 90 seidene Kleider befanden, aber nur wenige und schlechte Wäsche. »Ich war sehr schlecht ausgestattet nach Russland gekommen«, schreibt Katharina II. in ihren Memoiren, »ein Dutzend Hemden war meine ganze Wäsche.« Man legte mehr Wert darauf, daß die Wäsche kostbar ausgestattet, als daß sie sauber war. Kaum eine Zeit war z. B. in der Verwendung von Spitzen so verschwenderisch wie das 18. Jahrhundert. Man trug sie nicht nur als Besatz, an Kleidern und Leibwäsche sondern verzierte auch die Bettwäsche damit.
Madame de Créquy besuchte einmal die Herzogin de la Ferté und findet sie in einem Bett, dessen Spitzengarnitur 40000 Taler gekostet hatte. Die Marquise von Pompadour besaß ein Spitzenkleid von points d‘ Angleterre, das ihr 22500 Francs (etwa 60000 M.) gekostet hatte. Die Spitzenmantillen, mit denen man den Ausschnitt bedeckte, waren ebenfalls kostspielige Artikel, man bezahlte sie mit 100 Dukaten und mehr. Im Trousseau 1) der französischen Prinzessin, die 1739 den Infanten von Spanien heiratete, befanden sich für 625000 Francs Spitzen und noch 1786 schreibt Swinburne aus Paris, daß man im Trousseau jeder vornehmen Braut allein an Spitzen für etwa £5000 finden könne.
1) Trousseau: Die Kleidung und Bettwäsche, etc., die eine Braut für ihre Hochzeit und ihr Eheleben sammelt. Hochzeitsgeschenk für Erzherzogin Elisabeth Marie von Österreich.

Es zeigt rechts alle Edelweiss-Stern-Diamantschmuckstücke, die von A. E. Köchert hergestellt und von Kaiserin Elisabeth im berühmten Porträt von Winterhalter im Haar getragen wurden. Dies ist die letzte bekannte Aufnahme aller kompletten Sterne, bevor sie im Laufe der Zeit von der Erzherzogin und ihren Erben einzeln verschenkt wurden. Quelle: Österreichs Illustrierte Zeitung. Heft 17. S. 312.
In Baden war es 1739 guter Ton, für beide Geschlechter die spitzenbesetzte nasse Wäsche zum Trocknen vor seinem Fenster aufzuhängen, dazwischen promenierte dann die elegante Welt und bewunderte die ausgebreiteten Herrlichkeiten. Viele konnten sich von ihren Spitzen nicht trennen. Aurora v. Königsmarck nahm ein Vermögen an Spitzen in den Sarg mit, ebenso wie der Herzog von Alba, der 1739 in Paris mit allen seinen Spitzen begraben wurde.
In England war man nicht weniger toll auf Spitzen wie in Frankreich und anderswo. Die Königin Anna gab z. B. im Jahr 1712 für Spitzen £1418 aus. Ein Kopfputz aus Points de Bruxelles kostete 1719 £30 – £40. Auf zwei Millionen Pfund Sterling berechnete man im Durchschnitt die jährliche Einfuhr an flandrischen, französischen und italienischen Spitzen. Aus patriotischen Rücksichten begann man unter der Regierung Georgs II. die englischen Spitzen zu bevorzugen. Bei der Hochzeit des Prinzen von Wales 1736 trug die ganze Hofgesellschaft ausschließlich Spitzen englischen Ursprungs, nur der Herzog von Malborough machte eine Ausnahme, er trug Brüsseler Kanten.
Eine der berühmt schönen Misses Gunning, Anna Herzogin von Hamilton, seit 1759 Herzogin von Argyll, führte in den vierziger Jahren die Spitzenfabrikation in Schottland ein. Regierung und Private wetteiferten darin, die heimische Produktion in Flor zu bringen. Unnachsichtlich wurden ausländische Spitzen konfisziert. So revidierte die Steuerbehörde drei Tage vor der Hochzeit der Prinzessin Auguste mit dem Herzog von Braunschweig die Werkstätte der Hofmodistin und nahm ohne Barmherzigkeit die fertigen Galakleider fort, soweit sie mit ausländischen Spitzen oder anderen geschmuggelten Artikeln besetzt waren. Auf der Straße riß man den Frauen aller Stände Hauben und Besätze weg. In Dublin verbanden sich 1755 die jungen Herren zu einem Verein, welcher alle Damen, die französische Spitzen tragen würden, boykottieren wollte.
Seit 1756 die Blonde auftauchte, 1768 Hammond in Nottingham eine Maschine erfand, welche den Tüll – den man zuerst Fond de Bruxelles nannte – auf mechanischem Wege herstellte, kommt die Spitze allmählich außer Mode. Die indischen Musseline verdrängen sie wenigstens aus der Toilette, denn als Besatz der Bettwäsche bleibt sie in Ehren. Als 1778 Georg III. und die Königin Charlotte das Töchterchen des Herzogs von Chandos aus der Taufe hoben, da war der kleine Täufling so in Spitzen eingehüllt, daß er während der Zeremonie in seinem Tragkissen erstickte. Die Ehre der königlichen Patenschaft hatte »Georgiana Carolina« das Leben gekostet.
Die Frisur.
Die Frisur der Damen entwickelte sich im Gegensatz zum Umfang ihrer Röcke. Als der Reifrock am größten war, war sie ganz klein. Als Reifrock und Kleid enger und kürzer wurden, nahm sie in der gleichen Proportion zu wie jene ab. Auf die hochansteigenden Fontangen folgte eine Frisur, welche alles Haar knapp und flach um den Kopf legte, fast möchte man sagen anklebte. Man trug dazu kleine Spitzenhäubchen, die man 1731 Fledermäuse nannte, wenn sie tief bis in das Gesicht reichten. Seit 1760 etwa beginnt sich eine Veränderung geltend zu machen. Das Haar wird über der Stirn hoch toupiert und fällt hinter den Ohren in langen, meist nach vorn gelegten Locken auf den Hals.
Die Frisur wird kunstreicher und umständlicher in ihrer Herstellung, man braucht einen Friseur dafür. Der erste Mann, der in Paris Damen frisierte, war Mr. Frison, neben ihm waren Larseneur und Dagé berühmt. Der letztere besonders dadurch bekannt daß er sich geweigert hatte, die Pompadour zu frisieren. Der Matador der Pariser Friseure war aber doch Legros, der sich vom Küchenjungen zum Herrscher über die Köpfe der Damenwelt aufschwang; der das Haaremachen zur Kunst erhob. Er veröffentlichte 1765 ein methodisches Werk über die Kunst, jede Dame nach der Eigenart ihres Charakters zu frisieren und eröffnete gleichzeitig eine Akademie, die in drei Klassen eingeteilt, Wißbegierige in alle Geheimnisse des Metiers einweihte.
Die Frisur wird zur Hauptsache der Toilette. Erfindungsgabe und Phantasie werden nur noch in ihrem Dienst gebraucht. Eine neue Frisur wird zum Ereignis. 1772 bereits zeigte das Pariser Modejournal, der „Courier de la Mode“ in jedem seiner Hefte 96 verschiedene Arten Frisuren an, im ganzen Jahr sind es 3744 Beispiele. Der berühmte Legros gehörte zu den Opfern der Katastrophe, welche gelegentlich der Feste zur Vermählung Marie Antoinettes auf dem Platze Ludwigs XV. in Paris vielen Hundert Menschen das Leben kostete, er erstickte in der Menge. Aber sein Verlust bedeutete nichts. In wenigen Jahren war die Zahl der Damencoiffeure in Paris allein auf 600 gestiegen.
Die Damen, die Friseure, die Putzmacherinnen und Kammerjungfern wetteiferten in der Erfindung neuer und immer neuer Frisuren. Alle Gebiete der Natur und des Wissens wurden geplündert. Die Mythologie und die Neuigkeiten des Tages mußten Vorlagen liefern nur zum Besten neuer Ideen für die Frisur. Nichts war so widersinnig und so abgeschmackt, nichts so verkehrt und so sonderbar, daß es nicht zu einer Damenfrisur benutzt worden wäre. Sonne, Mond und Sterne, Meere und Wälder, Tier und Menschen sah man auf den Köpfen der Schönen.
Eine Fregatte mit allen Segeln war nichts Ungewöhnliches als Coiffüre und nachdem nichts mehr übrig zu sein schien, blieb es doch noch der Herzogin von Chartres vorbehalten, mit dem »Pouf au sentiment« etwas völlig Neues zu lancieren. Sie trug in dieser Frisur Figuren ihres kleinen Sohnes und seiner Amme, ihres Lieblingspapageien und Mohren, verflochten in Locken ihrer männlichen Verwandten, ihres Mannes, ihres Vaters und Schwiegervaters!?
Der eigentliche Wahnsinn beginnt aber doch erst in dem Augenblick, in welchem Marie Antoinette am 10. Mai 1774 Königin wird. Sie war jung, schön, töricht und schlecht beraten und stürzte sich wirklich Hals über Kopf in die Mode, so daß sie im ersten Jahre nach ihrer Thronbesteigung nur für Putz und Tand bereits 300.000 Francs Schulden gemacht hatte. Ihr Coiffeur war Leonard Autier, der berühmte, der große Leonard, der bis zu 14 Ellen Gaze in eine einzige Coiffüre hineinarbeitete und dessen Prinzip es war, niemals Spitzen zu verwenden. Der Coiffeur en titre der Königin war Larseneur, ein alter Mann ohne Geschmack, den sie aber aus Mitleid nicht abschaffen wollte. Sobald er fertig war, zerstörte sie seine Arbeit, Leonard kam und frisierte sie aufs neue. Marie Antoinette konnte sich nicht von ihm trennen und nahm ihn sogar auf die unglückliche Flucht nach Varennes mit, deren verfehlten Ausgang er durch sein Zuspätkommen verschuldet haben soll.
Die Putzmacherin der Königin war Mlle. Bertin. Mit beiden »arbeitete« die Königin mehrere Male in der Woche und kreierte die Moden, um die sich die Pariserinnen aller Klassen dann förmlich gerissen haben. Jede wollte, wie Madame Campan, die Kammerfrau Marie Antoinettes, in ihren Memorien schreibt, dieselben Modelle tragen wie die Königin, und man beschuldigte die Fürstin, daß sie durch ihre Launen der Verschwendung Vorschub leiste und den finanziellen Ruin Frankreichs befördere. Mlle. Bertin wurde der Minister der Mode genannt und sie fühlte sich auch als solcher.
Einmal kam eine Dame in ihren Laden und verlangte Coiffuren von der neuesten Mode. »Zeigen Sie der Dame die Modelle der letzten Woche«, befahl sie darauf einem ihrer Fräulein. Als die Käuferin schüchtern zu bemerken wagte, daß sie die neuesten, nicht die der letzten Woche sehen wollte, erhielt sie von der Bertin die stolze Antwort: »Dann müssen Sie noch acht Tage warten, die Königin und ich haben beschlossen, die neueste Mode erst in der nächsten Woche erscheinen zu lassen. Von ihrer Arroganz und Einbildung können die Memoiren der Zeit überhaupt nicht genug berichten. Trotz der exorbitanten Preise, welche die Gunst des Hofes ihr zu nehmen erlaubte, machte sie im Jahre 1787 einen Bankerott von zwei Millionen Passiva.
Marie Antoinette war so stolz auf ihre Erfindungsgabe, daß sie sich für ihre Mutter in der neuen Mode malen ließ. Die Kaiserin Maria Theresia sandte das Bild aber zurück mit der Bemerkung, es läge wohl eine Verwechslung vor, so könne vielleicht eine Schauspielerin aussehen, aber nicht die Königin von Frankreich! Die Frisuren wurden jetzt so extravagant nach Größe und Zusammensetzung, wie man sich heute doch kaum noch vorstellen kann. Die Baronin Oberkirch erzählt, daß bei Damen mittlerer Größe das Kinn genau in der Mitte zwischen den Fußspitzen und dem Gipfel der Frisur lag. Madame Campan sagt, daß die Damen sich nicht mehr in ihren Kutschen setzen konnten, sie mußten sich auf den Boden derselben knien und den Kopf zum Fenster hinaus strecken, gerade so wie ihnen das Tanzen große Mühe verursachte, da sie sorgfältig danach trachten mußten, Zusammenstöße mit den Kronleuchtern zu vermeiden.
Graf Vaublanc schreibt in seinen Erinnerungen, zu wie wenig geschickten Bewegungen die Tänzerinnen durch diese Rücksicht oft gezwungen waren. So soll es wirklich vorgekommen sein, daß eine Dame ihre Coiffüre an dem Lüster eines Pariser Caféhauses in Brand gesteckt hat. Um der Missbilligung der alten Tanten und Schwiegermütter zu entgehen, konnten sich junge Frauen »à la bonne maman« frisieren lassen. Dann kamen Ressorts in die Frisur, die auf einen Druck dieselbe höher oder niedriger machten. Es war als hätte eine Raserei diese Köpfe ergriffen, die sich nicht genug falsches Haar, Federn, Bänder, Blumen, Vögel aufsetzen konnten und nur begierig waren, für diese Chiffons immer neue Arten des Arrangements zu erfinden.
Madame de Matignon abonnierte sich bei dem Friseur Beaulard und zahlte ihm 24000 Livres jährlich, wofür er verpflichtet war, ihr täglich eine neue Coiffüre zu liefern. Die Mode wechselte so rasch, daß Leonard, wenn er von der gestrigen Mode sprach, nur »ehemals« zu sagen pflegte. Die Schwierigkeit, eine so komplizierte Frisur herzustellen, sie über Kissen und Drahtgestellen aufzubauen, ihr durch Pomaden Halt zu geben, sie zu pudern usw., erforderte die Arbeit von Stunden und es kann nicht wundernehmen, daß die Damen sich dieser Prozedur nicht alle Tage unterwerfen konnten. Selbst vornehme Damen ließen sich nur alle 8 bis I4 Tage neu frisieren, ärmere noch viel seltener und wir hören davon, daß Frauen und Mädchen des Mittelstandes einen Monat und länger ihr Haar in der gleichen Frisur beließen, ohne es doch in der Zwischenzeit kämmen zu können.
Was dieser Mangel an Reinlichkeit für Folgen hatte, läßt sich denken. Es war das goldene Zeitalter des Ungeziefers, dem die Damen mit ihren »grattoirs«, langen Kopfkratzern aus Gold oder Elfenbein, natürlich nicht beikommen konnten. Die Markgräfin von Bayreuth notiert bei ihrem Empfang in Hof, daß die Haare der adligen Damen voller Schmutz und Unrat gewesen seien und was Casanova einmal in dieser Hinsicht für Beobachtungen auf dem Kopf einer Augsburgerin machte, teilt er in seinen Memoiren sehr ergötzlich mit. Katharina II. verbot die Frisuren höher zu tragen als 1/4 russische Elle. Ihre Schwiegertochter Maria Feodorowna mußte sich deswegen einen Teil ihrer schönen Haare abschneiden lassen.
Nach einigen Jahren änderte sich die Mode insofern, als die Coiffure nicht mehr in das Haar hineingearbeitet, sondern als Haube oder Hut besonders aufgesetzt wurde. Man frisierte sich einfacher, angeblich dem Beispiel Marie Antoinettes folgend, der während ihres ersten Wochenbettes das Haar sehr stark ausgegangen war. Man toupierte es nicht mehr, sondern wickelte es in Locken und ließ es rückwärts bis zur Taille offen herabfließen. Im Aufstecken der Bonnets und Hüte waltete die Phantasie nun unumschränkt weiter. Drahtgestelle mit Flor überzogen, Formen aus Stroh und Filz wurden der Tummelplatz der launischen Mode, wo sie Federn, Blumen, Bänder, Schleifen, Agraffen u. a. in der buntesten und bizarrsten Mannigfaltigkeit durcheinander wirbelte. Ebenso barock wie die Formen der Frisuren, Coiffüren und Hüte waren die Namen, welche man ihnen beilegte.
Denn so gut wie jede Nuance jeder Farbe einen besonderen Namen erhielt, gab man jeder Frisur, jeder Coiffüre, jedem Hut einen eigenen Namen. Diese Bezeichnungen, die mit dem eigentlichen Wesen des Gegenstandes natürlich nicht das mindeste zu tun hatten, entlehnte man Tagesereignissen, dem Brand der Oper, dem Freiheitskrieg der Amerikaner, dem Halsbandprozess, man nahm Verbrecher zu Paten, wie den abscheulichen Desrues oder Erfinder wie Montgolfier. Man entlieh ihn am liebsten dem Theater. So begegnen wir Namen wie à l’Indépendance, à la Bostonienne, à la Philadelphie, à la nouvelle Angleterre, è la Belle Poule, au glorieux d’Estaing, à la Desrues, à la Montgolfière, à la Figaro, à l’Almaviva, à la Suzanne, à la Voltaire, à la nouvelle Clarisse, ä l’Androsmane, au Bandeau d’amour, le Chien couchant, au Parterre galant, au Cerf volant, à la douce Raillerie, à la Randan, à la Baillard, à la Zinzara, à la Tarare, à la nouvelle Omphale, à la Marlborough, à la grande Prétention, au Papillon constant, au galant Désespoir, au Plaisir de la Cascade usw. usw.
Wenn man bedenkt, dass es allein 1779 im Pariser Modehandel 200 verschiedene Häubchen gab, von denen jedes im Preise zwischen 10 und 100 Livres schwankend, einen besonderen Namen trug, so begreift man leicht, dass zwischen Himmel und Erde, auf und unter derselben nichts davor sicher war, der Verbindung von einigen Ellen Band, Flor und Federn seinen Namen leihen zu müssen. Dieselben Bezeichnungen begegnen uns auch in Deutschland. Wenn Chodowiecki oder Riepenhausen uns die Moden von Berlin, Göttingen oder Leipzig entwerfen, bedienen sie sich der gleichen Namen wie die Pariser Modezeitungen.
Zu den Formen, die sich fast das ganze Jahrhundert hindurch behaupteten, gehörte die Dormeuse, ein Name, der einer Haube zukam, die vielfach wirklich als Nachthaube benutzt wurde, wegen ihrer Einfachheit aber auch von älteren Damen gern getragen wurde. So sieht Goethe z. B. Frau von La Roche stets in einem »netten Flügelhäubchen«. Den Namen hat man dann gelegentlich im Jahre 1758 z. B. auch einem Topfhut beigelegt, wie man ihn 1909 wieder liebt, als ob man Mademoiselle Bertin Recht geben wollte, die einmal sagte: „Il n’y a rien de nouveau dans ce monde que ce qui est oublié.“ 1) Sehr drollig war die Coiffüre à la Thérèse, eine Kopfbedeckung wie ein Kutschdach, die man auf- und zuklappen konnte, praktisch und kokett zugleich. Diderot erzählt, wie gewandt seine kleine Tochter ihm die Vorzüge dieser Kalesche auseinanderzusetzen wusste.
1) „Es gibt nichts Neues auf dieser Welt, außer dem, was vergessen wird“.
Für die englische Dame war der Hut nicht nur der wesentlichste Bestandteil der Toilette, er erst gab ihr das Cachet der Eleganz, sondern sie verstand auch, ihn mit besonderem Schick aufzusetzen und mit feinster Koketterie zu tragen. Wer sich von Bildern, Farbstichen oder Radierungen von Porträts der schönen Engländerinnen jener Zeit besinnt, wird das Entzücken begreifen, mit dem der bekannte Zeitungsschreiber und Pamphletist Linguet erklärte, wenn Homer die Engländerinnen gekannt hätte, so würde er der Venus als Attribut der Grazien nicht einen Gürtel, sondern einen englischen Hut gegeben haben. Die reizenden Londonerinnen jener Zeit erfreuten sich aber auch einer Einrichtung, welche man heute, wo man stets auf der Suche nach neuen Berufen für die Frau ist, eigentlich nachahmen könnte. Die schöne Schauspielerin Mrs. Abington, welche am Drurylane Theater engagiert war und dort als Extrahonorar für ihre Toiletten £500 jährlich bezog, fuhr in ihren Mußestunden umher und erteilte Rat und Auskunft in Modeangelegenheiten, welche Nebenbeschäftigung ihr im Jahr etwa £1500 bis £1600 eingebracht haben soll.
Puder
Alle Frisuren hatten nur einen Zug miteinander gemein, sie waren alle gepudert. In den Zeiten Ludwigs XV. und Ludwigs XVI. puderte sich die ganze feine Welt, Mariner, Frauen Kinder stäubten sich ihr Haar dick mit Reismehl ein. Das graue Haar machte alle miteinander gleich alt. Sich alt zu machen, war der gute Ton, das Haar zu pudern etwas so Selbstverständliches, daß Friedrich Nicolai in Augsburg ein Gnadenbild der heiligen Jungfrau sah, dem an hohen Festen die Perücke frisch gepudert wurde. Für das Privileg, Puder erzeugen zu dürfen, zahlte Pietro Capranica dem Senat in Venedig 2000 Dukaten jährlich, aber sein Puder brachte ganze Schwärme von ekelhaftem Gewürm hervor. Erst sein Sohn führte den Reispuder ein.
Erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts setzt eine Bewegung gegen den Haarpuder ein, die Gründe der Reinlichkeit und der Philanthropie miteinander verbunden gegen das Pudern ins Feld führt. Man machte geltend, daß der enorme Verbrauch an Weizenmehl dem Volk die notwendigsten Nahrungsmittel verteuere und wenn das Haarpudern als allgemeiner Verbrauch auch erst im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts verschwunden ist, der Beginn der Bewegung liegt weiter zurück. 1764 sah Casanova auf einem Ball des Herzogs von Cumberland Lady Grafton mit ungepuderten, zwanglos in die Stirn fallendem Haar, eine Frisur, welche von allen Anwesenden mißbilligt wurde und daher binnen einem halben Jahr in ganz England allgemein getragen wurde. Sie inauguriert die Mode, welche uns auf den Köpfen der Modelle von Reynolds und Gainsborough so entzückt. Auf dem Kontinent hat es weit länger gedauert, bis man sich des Puders entwöhnte. Noch in den achtziger Jahren berichten Reisende aus England mit Erstaunen, daß selbst zierlich gekleidete Damen sich nicht zu pudern pflegten.
Schminke.
Das künstlich grau gemachte Haar schadete selbst dem jugendlichen Teint, wenn es ihn nicht ganz tötete. So zog das Pudern ganz von selbst das Schminken nach sich. Alfred Franklin, dessen Studien wir so schätzbares Material zur Kulturgeschichte der Moden, Trachten, Sitten und Gewohnheiten verdanken, sagt einmal sehr witzig: Die Dichter des 18. Jahrhunderts hätten ihre Heldinnen sich freigebig küssen und noch verschwenderischer Tränenströme vergießen lassen, während sie sich vor gar nichts so sehr hätten hüten müssen, wie gerade davor. Denn ihre Schminke gestattete ihnen derartig heftige Gefühle gar nicht. An das Waschen brauchte die Modedame von damals nicht zu denken, aber das Schminken durfte sie nicht vergessen. Wenn sie das Gesicht weiß angelegt hatte, zog sie die Brauen mit Schwarz nach, malte die Adern schön blau und dann wurden die Lichter mit Rot aufgesetzt. Das Rot war die Hauptsache. Der gute Ton verbot den anständigen Frauen, sich das Rot natürlich aufzulegen, nur die Damen von einem gewissen Metier durften sich mittels Rot »schön« machen, d. h. die Natur nachahmen. Die anderen mußten es à tranchant auflegen, d. h. so, daß man hundert Stund weit sah, daß dieses Rot Kunst sei.
Man hatte das Rot nicht nur in den verschiedensten Nancen und Zusammensetzungen trocken und flüssig, man suchte auch in der Art, wie man es auflegte, Gefühle und Stimmungen, sogar Standesunterschiede auszudrücken, wie sich denn die Damen des Versailler Hofes brandrote abgezirkelte Flecke dicht unter die Augen legten. »Ob die Frauen in Paris schön sind?« schreibt Leopold Mozart 1763 an seine Frau, »das ist unmöglich zu sagen, denn sie sind gemalt wie die Nürnberger Puppen und durch diese widerwärtigen Kunstgriffe derartig entstellt, daß eine von Natur schöne Frau in den Augen eines ehrlichen Deutschen völlig unkenntlich wird.«
Man besaß an Rot allein zehn verschiedene Sorten und hat trotzdem in Paris versucht, an seiner Stelle Lila aufzulegen. Martin in Paris führte eins der gesuchtesten rouge, von dem der Topf zwischen 60 und 80 Louisdor kostete. Wie stark der Verbrauch war, kann man beurteilen, wenn man hört, daß z.B, Madame Dugazon im Jahre 1781 bei dem Parfümeur Montclar sechs Dutzend Töpfe Rot kaufte, den Topf zu sechs Francs. Der Chevalier d’Elbée schätzte zur gleichen Zeit den jährlichen Verbrauch in Frankreich allein auf zwei Millionen Töpfe. Die Damen hatten ihre Schminkdöschen stets bei sich und erneuerten sich ungeniert, wenn sie es nötig fanden. Der Gebrauch war so natürlich, daß man sogar die Leichen schminkte. Mrs. Oldfield, eine bekannte englische Schauspielerin, hatte in ihrem letzten Willen festgesetzt, wie sie zum Begräbnis geschminkt sein wollte. Keyßler sieht in Rom 1730 die Leiche des Kardinals Pamphili rot geschminkt aufgebahrt.
In Frankreich war die Gewohnheit am1 tiefsten eingewurzelt, Madame de Monaco schminkte sich auch noch, als sie zur Guillotine gefahren wurde. In anderen Ländern schminkte man sich wohl auch, aber man trug das Rot doch nicht so fingerdick auf. Nicolai fällt es z. B. 1781 in Stuttgart angenehm auf, daß das Frauenzimmer von Stand sich das Rot zart und natürlich auflegt. Maria Lesczynska, Frau von Luwig XIV. und Königin von Frankreich, konnte ihren Widerwillen gegen die französische Art des Schminkens nie verbergen und erschien zu Casanovas Erstaunen sogar ungeschminkt bei ihrem Diner. Die Infantin Marie Therese von Spanien, welche 1745 den Dauphin heiraten sollte, war nur durch einen Befehl des Königs zu bewegen, sich Rot aufzulegen. Man fürchtete, ihr Bräutigam würde sich vor einer Ungeschminkten grausen.
Am Wiener Hofe durften sich die Damen nicht schminken, wenn Hoftrauer war. So wurde es ihnen z. Bspl. beim Tode des Kaisers Franz ausdrücklich verboten. Joseph II. verbot 1787 die weiße Schminke gänzlich als der Gesundheit schädlich und legte auf die rote eine hohe Steuer. Wie der Haarpuder die Unsauberkeit des Kopfes beförderte, so verursachten die Schminken, vielfach mit giftigen Substanzen versetzt, Hautausschläge, Augenkrankheiten und dauernde Kopfschmerzen. Aus diesem· allgemeinen Gebrauch des Schminkens erklärt sich das krasse Rot vieler Damenbildnisse der Zeit. Die Maler mußten ihre Modelle eben geschminkt malen, weil es für schön galt. Die meisten haben sich damit abgefunden, der berühmte Greuze allerdings weigerte sich, die Dauphine zu porträtieren, weil sie sich so rot angestrichen habe.
Die Mouches.
Den Abschluss der Gesichtstoilette bezeichnete das Anbringen der Mouches, kleiner Fleckchen aus gummierter schwarzer Seide oder Papier, die schon seit den Zeiten Heinrichs IV. Mode, den Höhepunkt ihrer Beliebtheit doch erst im 18. Jahrhundert erreichen. Man hatte sie in den verschiedensten
Formen als Sterne, Halbmonde, Sonnen, Kreise, Vierecke, Herzen, selbst in der Gestalt von Tieren und Männerchen. Es war durchaus nicht gleichgültig, an welche Stellen des Gesichtes man diese Fleckchen anbrachte. Man gab ihnen je nach ihrem Sitz besondere Namen. Mitten auf der Stirn hieß die Mouche die Majestätische, auf der Nase die Unverschämte, am Auge die Leidenschaftliche, am Mundwinkel die Küssefreudige. auf der Lippe die Kokette, inmitten der Wange die Galante, zwischen Mund und Kinn die Verschwiegene, auf einem Pickelchen endlich die Diebin.
Seit der berühmte Kanzelredner Massillon in einer seiner Predigten gegen den Gebrauch der Mouches geeifert und sich ironisch gewundert hatte, daß man sie nicht überall hinklebe, entschlossen sich die Damen wirklich dazu, sie auch auf dem Busen anzubringen, ja die geheimen Memoiren der Zeit versichern, sie hätten sich mit diesen sichtbaren Stellen noch nicht begnügt. Einen Augenblick lang trug man eine Mouche von schwarzem Samt so groß wie ein Pflaster auf der rechten Wange und nannte sie die Zahn schmerzliche. Madame Cazes trieb diese Mode ins Extreme, als sie diese Sammetpflaster noch mit Diamanten besetzte.
Der Schuh.
Die Chaussüre der Damen war der bekannte Stöckchenschuh, ein Halbschuh, der mittels eines etwa sechs Zoll hohen Absatzes den Hacken in die Höhe schob und den ganzen Fuß nach vorn drängte, wo die Zehen in scharfer Spitze zusammengepreßt wurden. Der Schuh bestand aus Stoff, aus Seide oder Leinen und wurde je nach Laune oder Geschmack reich mit Stickerei verziert, denn der kurze Reifrock ließ ihn ja voll zur Geltung kommen. Lederschuhe gab es nicht. Das schöne Geschlecht ging selten oder nie aus. Der Hauptschmuck des Schuhes bestand nächst seiner Kleinheit in den Schuhschnallen oder Schleifen, die ihn vorn zu schließen schienen. Eine Zeitlang hatte man in Paris auch an der Naht des Hakens kleine Schmuckstücke, die man »Venez-y-voir« nannte und gern aus Smaragden wählte.
Siehe: Schuhmode und Kostüme aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Schuhmode mit hohen Absätzen und Kostüme des Rokoko. Dame und Köchin dieser Periode im französischen Kostüm. Frauentrachten aus der 2. Hälfte des 18. Jh.
Man kann sich wohl denken, daß es für die Damen, die in ein enges, tiefschnürendes Korsett eingepanzert waren und turmhohe Frisuren zu balancieren hatten, keine geringe Aufgabe war, sich in diesem Schuhwerk zu bewegen. An schnelles Gehen war überhaupt nicht zu denken. Als Casanova einmal in Versailles den Damen der Königin begegnet, die aus irgendeinem Grunde genötigt waren, sich sehr rasch in einen anderen Raum zu begeben, sieht er sie mit hochgehobenen Reifröcken in halb hockender Stellung mit krummen Knien eilends davon hatschen, und als er, der die Damen dieses Hofes überhaupt sehr häßlich fand, sich erkundigte, warum sie sich gar so grotesk bewegen, hört er, das müßten sie, sonst fielen sie unfehlbar der Länge nach hin.
Der Zustand der Straßen erlaubte ja auch in damaliger Zeit gar kein Ausgehen zum Vergnügen. In London trugen die Frauen, mußten sie aus dem Hause, hohe, runde, eiserne Maschinen, wie kleine Stelzen, am Fuß, sonst begnügte man sich im Garten oder auf den seltenen Promenaden ein wenig herumzutrippeln. Erst als der berühmte Arzt Tronchin es unternahm, die Krankheiten dadurch zu heilen, daß er ihnen mittels einer naturgemäßen Lebensweise vorbeugte, und den Frauen als Heilmittel gegen das Modeleiden der Vapeurs fleißige Bewegung in freier Luft empfahl, griffen sie zu den langen Stöcken aus spanischem Rohr und »tronchinierten« ein wenig damit (was wir heute müllern nennen). Ein anderer Arzt, Roussel, wandte sich alsbald heftig gegen diesen Gebrauch, denn das unnütze Spazierengehen schade dem Temperament der Frauen und verwirre ihre Ideen.
In den achtziger Jahren nahmen die Damen den Herrenschuh mit flachem Absatz an, der sich im letzten Jahrzehnt zur völlig absatzlosen flachen Sandale wandelt. Der immer offen getragene Hals hätte eigentlich nach Schmuck verlangen sollen, aber das war merkwürdigerweise nicht der Fall. Man trug zur Zeit Ludwigs XV. um den Hals gern kleine Rüschen aus Spitze oder Band, aber weder Steine noch Perlen. Diamanten besetzten die Korsage und hingen in riesigen Fassungen in den Ohren, krönten auch die Frisur, aber Hals und Busen blieben frei von ihnen, an den Armen trug man Perlen schnüre mit einem Medaillon als Schloß, im Gürtel gern zwei Uhren mit Berlock wie die Herren.
Unter Ludwig XVI. trugen Frauen und Mädchen gern ein schmales Band um den Hals, an dem vorn am langen Ende ein Kreuzchen oder Medaillon hing. Als die Empfindsamkeit Mode war, fertigte man Schmucksachen aus Haaren und trug sie als Ringe, Armbänder und Ketten.
Wunderbar ist der Genuss, und hoch der Wert der Erhaltung
Mensch, verehre dich selbst! setz' dich den Dingen nicht gleich!
v. Knebel, Literar. Nachlass. Bd. I. S. 93.
Quelle:
- Die Mode; Menschen und Moden im achtzehnten Jahrhundert. Nach Bildern und Stichen der Zeit ausgewählt von Max von Boehn und Oskar Fischel. München, F. Bruckmann 1919.
- Illustrierte Geschichte des Kunstgewerbes von Georg Lehnert, Wilhelm Behncke. Berlin, M. Oldenbourg 1907.
Weiterführend:
- Frankreich. Die verschiedenen Arten, den Mantel à la balagnie zu tragen. Frankreich 17. Jh.. Mode unter Louis XIII. Die vornehmen Stände. Die Raffinés. Witwentracht. Gräfin von Saint-Balmont, die christliche Amazone. Mantel à la balagnie.
- Mode des späten Rokoko um 1780. Piémontaise, polonaise. Frauen in der Mode aus dem zweiten Drittel des 18. Jh., von Pierre Thomas le Clerc und Nicolas Dupin.
- Reifröcke, Paniers und Justaucorps. Die Mode im 18. Jh. Die männliche Garderobe zur Zeit von Ludwig XV. Der Herrenrock, Justaucorps. Paniers, die Reifröcke, die Krinoline im Zeitalter des Rokoko und Barock des 18. Jahrhunderts.
- Der Casaquin, pet-en-l’air oder Caraco. Historische Figuren und Modetypen unter Ludwig XV. Der Casaquin, pet-en-l’air oder Caraco ist eine Frauenjacke, die von der Mitte des 18. bis frühen 19. Jahrhunderts in Mode war.
- Die grosse Staatsrobe. Modetypen in Frankreich 1775-1785. Modezeichnungen im Frankreich des 18. Jahrhunderts.
- Französische Moden. Schlafröcke und Schlafmützen des Barock. Frankreich 17. & 18. Jahrhundert.
- Französische Mode von 1670-1700. Epoche von Ludwig XIV.
- Die charakteristischen Merkmale der Mode in der Epoche von Ludwig XIV. Kostüme des Adels. Die Mode der Perücken.
- Mode unter Louis XIV. Weibliche Kostüme Ende des 17. Jh. Weibliche Kostüme Ende des 17. Jh. Geschichte des Kostüms von Auguste Racinet.
- Hof,- und Staatstrachten unter Ludwig XIV. Hofetikette bei einem Staatsempfang. Audienz im Schlafzimmer des Königs.
- Weibliche Moden in Frankreich des 17. Jhs. Die Palatine. Zweite Hälfte der Regierung Ludwigs XIV. Die Palatine und der Casaquin. Die Cope oder der Kopfschal; der Muff. Halstuch à la Steinkerque. Die Spitzenschürze. Der Spazierstock der Damen mit Handschleife. Toilette einer Dame vom Stande. Gesellschaftstoilette.
- Bürger, Handwerker, Adel in Frankreich, 17. Jh. Tänzer im Ballkostüm; Musiker, Bürger, Handwerker und Adel. Die Trachten dieser Figuren gehören der Zeit von 1675 bis 1680 an.
- Hof,- und Staatstrachten unter Ludwig XIV. Hofetikette bei einem Staatsempfang. Audienz im Schlafzimmer des Königs.
- Kleidung des Adels unter Ludwig XIV. von 1646 bis 1670. Die Könige der Mode. Seit 1648 übten die politischen Ereignisse einen bestimmenden Einfluss auf die Mode aus, man trug à la Fronde, à la paille, au papier.
- Militärische Ritterorden im 17. & 18. Jahrhundert. Das Tragen der militärischen Ritterorden im bürgerlichen Leben im 17. & 18. Jh..
- Die Bagnolette und Mantille. Frankreich 18. Jahrhundert.
- Spanische Kleidermode. Halskrausen, Frisuren Kostüme. Mode des Barock in England. Tudor Mode. 16. und 17. Jahrhundert.
- Empfangssaal eines vornehmen Hauses in Paris des 17. Jhs. Empfangszimmer Cabinet de l’amour im Hôtel Lambert, einer der prächtigsten Stadtpaläste von Paris.
- Englische Mode zur Zeit des Rokoko. Geschichte des Kostüms in chronologischer Entwicklung von Auguste Racinet.
- Salon der eleganten Gesellschaft in Holland um 1650.
- Mode in Frankreich und Flandern im Barock. 17. Jahrhundert.
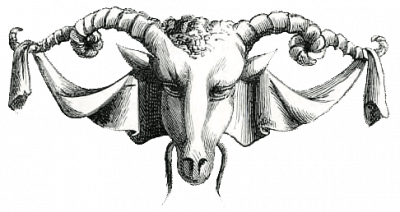

Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!